Die Frau, die heute vor 98 Jahren geboren wurde, ist mir in meinem Leben in der Bundesrepublik der Nachkriegszeit öfter "über den Weg gelaufen", sei es als Journalistin, Förderin von Kinder- & Jugendliteratur und Kochbuchautorin: Der Name Sybil Gräfin Schönfeldt hatte dabei immer einen guten Klang.
Anna Sybil Gräfin Schönfeldt kommt also am 13. Februar 1927 als Tochter der 21jährigen Carmen Sackermann und des österreichischen Reichsgrafen Carl von Schönfeldt, bei ihrer Geburt 29 Jahre alt, in Bochum zur Welt. Die Mutter, Tochter eines Sohnes eines Zuckerbarons & Plantagenbesitzers in Manila auf den Philippinen, stirbt Ende März des Jahres, sieben Wochen nach der Geburt des Babys, an einer Sepsis, damals unter dem Namen "Kindbettfieber" bekannt und vor hundert Jahren noch eine der häufigsten Todesursachen bei frisch gebackenen Müttern.
"... ich hab' ja dadurch, dass meine Mutter bei meiner Geburt gestorben ist, auch den Tod als frühen Begleiter. Das ist immer erwähnt worden. Immer stand jemand und sagte 'Ach das arme Kind' oder es sagte irgendjemand, 'Das hätte deine Mutter aber nicht getan'. Das heißt also, ich hab' von Anfang an miterlebt, wie lebendig der Tote sein kann." ( Quelle hier )
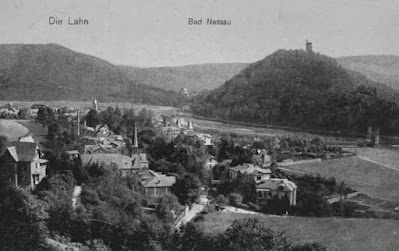 |
| ca. 1917 |
Anschließend wird von der Familie entschieden, dass Sybil bei ihrer mütterlichen Großmutter und ihrem Stiefgroßvater in Göttingen in deren Wohnung in der Herzberger Landstraße leben soll. Dort besucht sie die Albanischule, eine Volksschule.
Der Vater führt derweil ohne seine Tochter sein eigenes Leben und arbeitet bei der deutschen Filmgesellschaft Ufa als Pressesprecher. Als er zum zweiten Mal heiratet - ein "Ufa-Sternchen", so Sybil - wird das siebenjährige Kind nach Berlin geholt, "um endlich eine Familie zu haben." Dort bleibt sie Außenseiterin und hat nur mit der ebenfalls ausgeschlossenen jüdischen Mitschülerin Kontakt, bis diese verschwindet. Weil sie nicht so recht zum Lebensstil des Vaters passt, kommt sie letztendlich wieder zurück zur Göttinger Großmutter, die Sybil als Ersatz für die verlorene Tochter schätzt und an die glanzvolle Zeit, die sie, reich & angesehen, auf den Philippinen verbracht hat, erinnert. Den Schwiegersohn macht sie zeitlebens für den Tod ihrer schönen Tochter verantwortlich, so dass der den Kontakt so minimal wie möglich hält.
"Aber wenn ich an diese Zeit zurückdenke, so sehe ich, wie ich instinktiv das vermutlich Einzige tat, das mich rettete: überschwängliche Liebesbeteuerungen und Wegducken." ( Quelle hier )
Ihre Autobiografie "Sonderappell", die 1979 erscheinen wird, ist eine Abrechnung mit dieser Zeit und dem Drill der Mädchen in dieser Institution. Sie erlebt Furchtbares bei den Rückzügen der sogenannten Volksdeutschen "heim ins Reich", die auf den Bahnhöfen zu betreuen ihr zugeteilt worden ist. Sybil schildert im Buch ihre Entwicklung von einer überzeugten Hitler-Anhängerin zur politischen Autorin, die sich schämt, nicht eher das Grauen des Regimes erkannt zu haben. Das Buch wird nicht nur positiv aufgenommen:
"Die Beteiligten haben mich natürlich aufs Korn genommen und haben gedroht, haben angerufen und gesagt, das sei Nestbeschmutzung.... Und es hat sich herausgestellt, dass die Führer und Führerinnen des Reichsarbeitsdienstes keine Parteigenossen werden mussten, infolge dessen hatten all die jungen Leute eine schneeweiße Weste. Sie waren Anfang und Mitte 20 und waren Heimleiter oder so was Ähnliches und sind ohne mit der Wimper zu zucken in die deutsche Pädagogik hinübergegangen, sind Lehrer geworden, Geschichtslehrer geworden. Sie haben ihrerseits wieder Heime geleitet und sie haben alle Unterlagen, Arbeitslisten und so weiter sichergestellt", erzählt sie später über die Reaktionen, die das Buch hervorgerufen hat. ( Quelle hier )
Das Kriegsende erlebt die junge Frau bei einer Freundin der Großmutter in Augsburg, wohin sie sich über Prag & Böhmen durchgeschlagen kann:
"Das war ein solches Glück, eine solche Freiheit. Davor war man immer in Organisationen, die ganze Zeit eingeteilt, ständig eingespannt. Und jetzt wieder ein einzelner Mensch, man musste nicht bei jedem Geräusch den Kopf einziehen, der Himmel war frei, keine Flugzeuge, keine Angst, kein Alarm. Man konnte endlich machen, was man wollte. Und lesen, was man wollte." ( Quelle hier )
Nachdem sie einen Passierschein bekommen hat, kann sie im Sommer nach Göttingen heimkehren. Nach dem Übergangsabitur ( "mit einer gewissen Mühe" ) 1946 studiert Sybil zunächst an der Georg-August-Universität Göttingen Germanistik, Englisch und Kunstgeschichte, später in Heidelberg & Hamburg. Ihren Lebensunterhalt verdient sie sich selbst: "Ich habe stundenweise Hemden gebügelt, Hunde ausgeführt, Hamburger Stadtpläne handkoloriert."
1947 heiratet ihr Vater, der mittlerweile Nachrichtensprecher von Rot-Weiß-Rot unter dem Pseudonym Rudolf Hornegg ist, in Wien ein drittes Mal ( die spätere Organisatorin des Opernballs, Christl Arnold, übrigens ). Er überredet sie zum Studium in Wien:
"Mit Wien verknüpfe ich besondere Erinnerungen. Plötzlich hatte ich zwei Schwestern und einen lang ersehnten Bruder, mit dem ich viel und über alles reden konnte. Ich hatte, so könnte man sagen, ein richtiges Zuhause mit Geschwistern. Nachdem ich vorher nur bei alten Menschen gelebt hatte, stellte sich bei mir ein völlig neues Lebensgefühl ein."
In Wien promoviert sie 1951 über "Formprobleme in der Lyrik Josef Weinhebers". Es schließt sich ein Volontariat beim "Göttinger Tageblatt" 1952 an. Dann geht sie nach Hamburg. In den ersten Jahren ihrer journalistischen Tätigkeit gehört sie zur Redaktion der Frauenzeitschrift "Constanze" ( Vorgängerin der "Brigitte" ) und arbeitete unter anderem für den "Stern". Ihr erster Artikel für "Die Zeit" hat gleich große Wirkung: Ein Zehnzeiler über ein grässliches Kinderheim in einem düsteren Tal bei Göttingen führt zu dessen Schließung.
Der Feuilletonchef der "Zeit", Paul Hühnerfeld, beauftragt sie als eine der wenigen Frauen der Redaktion, über den gerade 1956 gegründeten Jugendbuchpreis zu berichten, bei dem sie Jurorin wird. Gemeinsam etablieren sie die Kinder- und Jugendliteraturkritik in der Wochenzeitung. Es sind die Jahre, in denen Kinderbuchverlage wie Dressler, Oetinger, Erika Klopp, Ravensburger und dtv junior von Frauen geleitet werden, und Sybil wird ein wichtige Figur dieser Szene. Aber nicht nur das: Sie übersetzt auch Klassiker aus dem Englischen wie "Alice im Wunderland" von Lewis Carroll oder Roald Dahls "Hexen hexen", Rudyard Kiplings "Dschungelbuch", Richard Carpenters "Catweazle, der große Zauberer", Charles Dickens und Edith Nesbit - insgesamt werden es 120 Titel werden. "Die Zahl der Übersetzungen war bei der Kinderliteratur am höchsten zwischen Ende 30 bis Anfang 50 Prozent."
In jener Zeit lernt Sybil den sechs Jahre älteren Kaufmann Heinrich Schlepegrell kennen, mütterlicherseits der Familie Mendelssohn verbunden, vom Vater her mit einer niedersächsischen Ur-Adelsfamilie aus Lüneburg. 1957 heiraten sie, bekommen 1959 einen ersten Sohn, Henry, 1961 dann Ludwig.
Um ihre Kinder betreuen zu können, kündigt sie "mitten auf dem Weg nach oben": "Ein schwieriger Entschluss, denn ich sollte gerade nach zehn Jahren in der Redaktion in die Chefetage der Constanze wechseln." Sie bleibt nun Freiberuflerin. Dankbar ist sie später für die daraus resultierende Erweiterung ihrer Themenkreise, darunter das "Knaurs Großes Babybuch" von 1969, "Knaurs Buch vom Kind" der Europäische Bildungsgemeinschaft von 1972 oder "Die Großmutter und ihr Enkelkind. Der moderne Ratgeber für Erziehung, Pflege, Beschäftigung" von 1975. Mit "Glückliche Kinder brauchen Großmütter" greift sie das Thema 1994 noch einmal ganz anders auf.
Die Gräfin Schönfeldt wandert als Künstlername auf ihre künftigen Buchtitel.
Sie übernimmt das Lektorat der Romanredaktion der "Zeit" und wird Leserbriefredakteurin im Bauer-Verlag. Über Bauer gerät sie in die Welt der Kochbücher. Da der Verleger geizig ist, geht sie dafür in das Kochlabor von Maizena. Ihr erstes Kochbuch ist "Das Beyer-Kochbuch. Eine Kochlehre in Grundrezepten. Ernährungslehre, Küchen- und Vorratspraxis, Arbeitsmethoden" (1963).
Die Leidenschaft für gutes Essen ist bei Sybil schon in frühester Kindheit gelegt worden. Keinen geringen Einfluss hat die Großtante Friederike gehabt. Die hat viele Rezepte und praktische Haushaltstipps in ein dickes rotes Buch geschrieben, das Sybil geerbt hat. Ihre Großmutter mit der philippinischen Vergangenheit, die "Manila-Oma", hat damals auch einiges notiert, später nur noch die Zutaten ( die Mengen hatte sie im Kopf ). Von ihr aus dem schwarzen Kochbuch wird Sybil später einige Reisgerichte übernehmen. Sie wird auch Gründungsmitglied der Zeitschrift "Essen & Trinken", die 1972 erstmals erscheint.
1977 wird ihr der Große Preis der Deutschen Akademie für Kinder- und Jugendliteratur verliehen. Von 1981 bis 1984 ist Sybil Vorsitzende des Arbeitskreises für Jugendliteratur. 1987 Jahre kommt ihre Benimm-Fibel "Einmaleins des guten Tons" heraus und wird zum Bestseller. "Manche sagten damals zu mir 'Benimmpäpstin'"... "In den Achtzigerjahren war das ein "Kotz-Kotz-Thema". Wenn du dann auch noch Gräfin heißt, haben die Leute sofort ein völlig falsches Bild. "
"Gutes Benehmen ließe sich für alles missbrauchen, instrumentalisieren. Um sich einzuschmeicheln, besser zu verkaufen oder die Welt zu belügen. Hitler habe schließlich auch zur Eröffnung der Bayreuther Festspiele einen Frack getragen. Der Kern sei wichtig. Das sittliche Empfinden, Wahrhaftigkeit und Echtheit. Moral und Manieren als Basis für den Umgang miteinander. Beides. Nur Moral sei unerträglich und nur gute Manieren seien auch zu verachten", sagt sie im Alter an dieser Stelle.
Von 1989 bis 1991 unterrichtet Sybil Gräfin Schönfeldt dann künftige Journalisten an der Henry-Nannen-Schule in Berlin.
 |
| 1990er Jahre |
Für die Rowohlt Monografien verfasst sie 1987 ein Porträt der Astrid Lindgren ( neun Auflagen bis 2003; 2007 neu überarbeitet ):
"Der Oetinger Verlag hatte im Hamburger Pressehaus auch sein Büro und ich lernte Astrid kennen, als sie dort zu Besuch war. Wir redeten nur über Bücher, und als ich die Monografie schrieb, merkte ich, wie wenig ich sie nach so vielen Jahren als Mensch kannte. Sie lud mich nach Schweden ein in ihr Sommerhaus, Anfang der Achtzigerjahre. Und erzählte mir zuletzt, dass sie nach Stockholm gegangen war, um da ihr uneheliches Kind zu bekommen. Davon hatte in Deutschland noch niemand gehört. In Schweden wurde es durch eine unautorisierte Biografie bekannt, und sie war wütend: "Es geht niemanden was an." Sie hatte dafür gesorgt, dass diese schwedische Biografie in Schweden blieb und nicht übersetzt wurde. Mich hat immer aufgeregt, dass dieses Thema aus der Sicht der Männer beschrieben wird - nicht, dass da ein älterer Mann eine junge Frau ausnutzt. Darum habe ich gerade noch einmal meine Erinnerungen über sie aufgeschrieben." ( Quelle hier )
Seit 1960 lebt Sybil in einer alsternahen Dachwohnung in Hamburg - Winterhude, in der sie lange Zeit selbst die Gastlichkeit pflegt - am ehesten ihre Heimat:
"Wenn ich mich in meinem Zuhause umschaue: Ich habe den Schreibtisch meiner Großmutter, das Bücherregal der Großtante, die Bilder vom Ururgroßvater. Wenn man so etwas um sich hat, ist es leichter, von Heimat zu sprechen. Der Blick auf die Wurzeln der Familie gibt Halt. Auch in Zeiten des Sturms." ( Quelle hier )
Dort betreut sie auch über mehrere Jahre ihren kranken Ehemann, bis der am 27. März 2007 zuhause im Kreise seiner Familie stirbt."Heinrichs Tod hatte damit begonnen, dass er nicht mehr wusste, wer ihm gegenüber saß..." Ihren 80. Geburtstag und die Goldene Hochzeit haben sie im letzten gemeinsamen Jahr noch begehen können.
Je größer die Trauer und folgenreicher das Altwerden, desto mehr fordert sie von sich, trotz schlechter Gesundheit mit preußischer Disziplin weiterzuarbeiten: "Wenn du dich erst gehen lässt, bist du verloren". Sie schreibt bis zuletzt nicht am Computer, sondern mit einem penibel gespitzten Bleistift, linkshändig.
 |
| 2020 |
2018 kommt, basierend auf den eigenen Erfahrungen, das "Kochbuch für die kleine alte Frau" heraus. Im gleichen Jahr der "Knigge für die nächste Generation", 2019 das "Kochbuch für den großen alten Mann" und schließlich 2023 "Er und ich. Erinnerungen", in der sie Anekdoten & Geschichten aus ihrem Leben mit denen aus dem ihres Mannes bzw. aus ihrer gemeinsamen Zeit als Paar & Familie verknüpft hat.
Als es veröffentlicht wird, ist sie schon tot, gestorben mit 95 Jahren nach kurzer Krankheit am 14. Dezember 2022, anschließend bestattet auf dem Ohlsdorfer Friedhof...
Ich war überwältigt, als ich hier die Liste all dessen studiert habe, was Sybil Gräfin Schönfeldt geschrieben hat. Daraus ablesen lässt sich auch, welche Rolle, welchen Einfluss sie auf das bundesrepublikanische Alltags- wie Literaturleben gespielt und gehabt hat. Da ist es mir auch sehr schwer gefallen, meine Darstellung zu straffen.









Was für eine großartige und kluge Frau! Und wie schön, Du sie beschrieben hast.
AntwortenLöschenIch bin voll Bewunderung für sie und wie sie das mit ihrem Leben hinbekommen hat in all der Unsicherheit und Unstetheit, die ihr von Kindheit an zugemutet wurde.
"Der Kern sei wichtig. Das sittliche Empfinden, Wahrhaftigkeit und Echtheit. Moral und Manieren als Basis für den Umgang miteinander. Beides. Nur Moral sei unerträglich und nur gute Manieren seien auch zu verachten".
Danke Sybil Gräfin Schönfeldt!
Und Dir auch, liebe Astrid für dieses feine Portrait.
Herzlichst,
Sieglinde
Was für eine fasznierende Frau!
AntwortenLöschenHab Dank für deine Recherchen
Herzlichst
yase - die auch gerne mit Bleistift schreibt, links 😊
Eine Frau, die ich allein durch meine Ausbildung im Buchhandel kennen gelernt habe, natürlich nicht persönlich, aber sie war u.A. dort so wichtig und so eine imponierende Frau. Bis zu ihrem Tod hat sie sogar noch den bekannten Literischen Küchenkalender herausgebracht.
AntwortenLöschenDanke für ein weiteres Frauenportrait
Mit lieben Grüßen
Nina
Sie begleitete mich vom Großen Babybuch bis zum Kochbuch der kleinen alten Frau. Welch eine Spannweite.
AntwortenLöschenVielen lieben Dank für dieses ausführliche Portrait.
Herzlichst Elisabeth
Vielen lieben Dank für dieses Porträt, liebe Astrid...welch eine interessante Frau, die gerade in ihrer Kinder- und Jugendzeit viele wechselnde Beziehungen zu Vertrauenspersonen meistern musste. Der Name deiner Vorstellung sagte mir etwas und so kam ich drauf, dass sie diejenige war, die öfter in meinem Örtchen bzw. einem Stadtteil als Literatur-Kennerin viele Neuerscheinungen vorstellte. Leider habe ich solch eine Veranstaltung nicht besucht und sie nicht live erleben können, so schade im Nachhinein.
AntwortenLöschenEinen lieben Gruß von Marita
Was für eine überraschende Biographie. Denn natürlich kannte ich ihren Namen, doch hatte ich ihn hauptsächlich mit Kinderliteratur und Übersetzungen in Verbindung gebracht. Wahnsinn, was die Frau alles geschafft hat.
AntwortenLöschenLiebe Grüße
Andrea
Ganz herzlichen Dank für diesen wunderbaren, interessanten Artikel über das Leben von Sybil Gräfin Schönfeldt. Ich habe sie mehrmals live erlebt. Sie hat für Buchhändler*innen Fortbildungen zu Kinder-und Jugendliteratur angeboten und
AntwortenLöschenauch ihre Empfehlungen zu den jährlichen Neuerscheinungen auf dem Buchmarkt waren großartig und lohnenswert. Ganz viel aus ihrer Kindheit und Jugend erfahre ich jetzt über Ihre "Fleißarbeit" in diesem Porträt.
Herzlichen Dank ! Und freundliche Grüße schickt Marie
ludwig ist 1961 geboren. ebender
AntwortenLöschen🤣 Danke & liebe Grüße!
Löschen